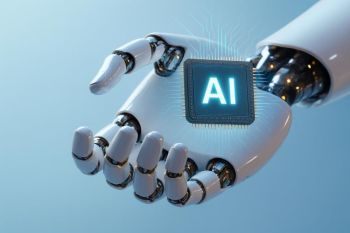Von Christian Kuster, CTO Huawei Enterprise Switzerland
Die Schweizer und die europäischen Energienetze stehen vor einem Paradigmenwechsel. Dezentrale Einspeisung, volatile Produktion und bidirektionale Energieflüsse überfordern traditionelle Infrastrukturen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Versorgungssicherheit: Cyberangriffe auf kritische Anlagen nehmen zu, manuelle Inspektionsprozesse skalieren nicht mehr, und Legacy-Systeme blockieren die Integration neuer Dienste.
Die Antwort liegt nicht allein in mehr Windrädern oder Solarpanels. Sie liegt in der Konvergenz von Energie- und Datentechnologie.
Digitale Zwillinge als Betriebssystem
Das Konzept des Energie-Internets basiert auf der Idee, physische Infrastrukturen – von Umspannwerken bis zu Verteilnetzen – vollständig digital abzubilden. Sensoren erfassen Betriebszustände, 5G-Netze übertragen Daten in Echtzeit, KI-Algorithmen analysieren Muster und treffen vorausschauende Entscheidungen.
In der Praxis bedeutet das: Wartungsbedarfe werden erkannt, bevor Ausfälle entstehen. Energieflüsse werden sekundengenau an Angebot und Nachfrage angepasst. Und Netzbetreiber erhalten eine Transparenz, die mit konventionellen Supervisory Control and Data Acquisition-Systemen (SCADA) nicht erreichbar ist.
Pilotprojekte in nordeuropäischen Windparks zeigen die Potenziale: Edge-Computing-Lösungen verarbeiten Inspektionsdaten direkt vor Ort, private 5G-Campus-Netze sichern die Übertragung kritischer Betriebsdaten, und KI-gestützte Analysen reduzieren Wartungskosten um bis zu 30 Prozent. Die Technologie ist verfügbar – die Frage ist, wie schnell Energieversorger sie integrieren.
Konnektivität als limitierender Faktor
Die Digitalisierung des Energiesektors steht und fällt mit der Verfügbarkeit leistungsfähiger Kommunikationsnetze. Glasfaser und 5G sind keine Zukunftsvision mehr, sondern Grundvoraussetzung. Ohne niedrige Latenzen und hohe Bandbreiten bleibt die Vision eines Energie-Internets, das Millionen Endgeräte, Fahrzeuge und Gebäude intelligent vernetzt, technisch nicht umsetzbar.
Besonders private 5G-Netze gewinnen an Bedeutung: Sie ermöglichen Energieunternehmen, kritische Infrastrukturen unabhängig von öffentlichen Netzen zu betreiben und Cybersecurity-Risiken zu minimieren. Gleichzeitig schaffen offene Plattformarchitekturen die Basis, um bestehende IT-Landschaften schrittweise zu modernisieren – ohne disruptive Migrationen.
Sektorenkupplung: Schlüssel zur Energiewende
In naher Zukunft wird die Nachfrage nach Strom und Kühlung in Transport, Rechenzentren, Heizen und Kühlen deutlich steigen. Ein Eckpfeiler dieses Übergangs ist die Sektorenkopplung, die intelligente Integration von Strom mit Wärme, Kälte, Transport und industriellen Prozessen. Durch Elektrifizierung und Technologien wie Power-to-Heat, Power-to-Hydrogen und Power-to-Mobility können wir die Gesamteffizienz steigern, die Flexibilität im Ausgleich von Angebot und Nachfrage erhöhen und die Dekarbonisierung der Wirtschaft beschleunigen.
Schweiz: Infrastruktur trifft Regulierung
Die Schweiz verfügt über eine aussergewöhnlich gute Ausgangslage. Mit einer 5G-Netzabdeckung von über 98 Prozent der Bevölkerung und einer der höchsten Glasfaserdurchdringungen Europas existiert die technische Basis bereits. Hinzu kommt ein regulatorisches Umfeld, das private Netzinfrastrukturen für Energieanwendungen aktiv fördert.
Dennoch bleibt die Skalierung herausfordernd: Die föderale Struktur des Energiemarktes, unterschiedliche Standards zwischen Kantonen und die Integration heterogener Legacy-Systeme bremsen den Rollout. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, technologische Insellösungen in interoperable Ökosysteme zu überführen.
Vom Versorger zur Plattform
Die Transformation verändert Geschäftsmodelle fundamental. Energieversorger entwickeln sich von reinen Distributoren zu Plattformanbietern, die Erzeuger, Speicherbetreiber und Verbraucher über Sektorengrenzen dynamisch koordinieren. Konsumenten werden zu Prosumenten, die Energie nicht nur beziehen, sondern auch einspeisen und handeln.
Technologieanbieter wie Huawei treiben diese Entwicklung mit integrierten Lösungen voran, die Telekommunikations-, Cloud- und Energietechnologien verbinden. Die Frage für CIOs lautet nicht mehr, ob diese Transformation kommt – sondern wie schnell ihre Organisation bereit ist, die nötige Infrastruktur aufzubauen.
Das Energie-Internet wird zur kritischen Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Wer heute investiert, definiert morgen die Standards.
Weiterführende Information
Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel im Whitepaper «Die Rolle der IKT in der Digitalisierung des Energiesektors». Das vollständige Whitepaper, welches von energie-cluster.ch und OE-EN gemeinsam mit zahlreichen privaten und öffentlichen Partnern initiiert wurde, steht unter
oe.energy/publications zum Download bereit.