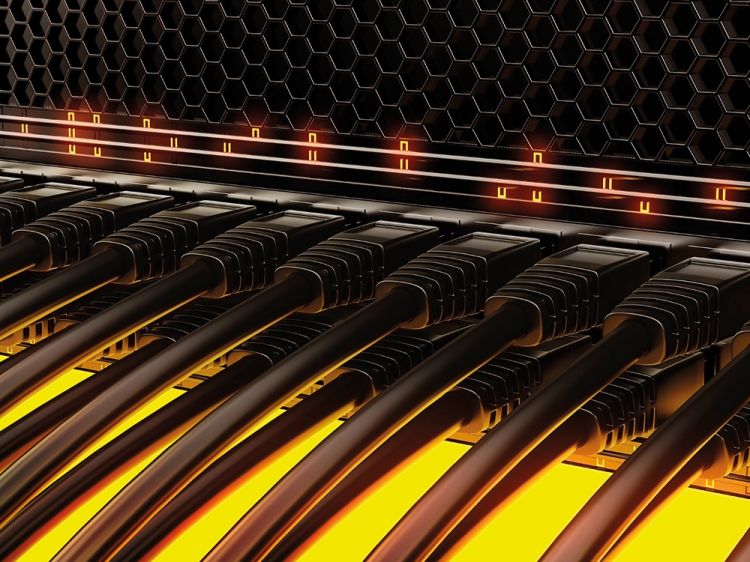Continuous Threat Exposure Management, kurz CTEM, dreht die Perspektive um: Unternehmen betrachten ihre IT-Landschaft so, wie es ein Angreifer tun würde. Statt erst dann zu reagieren, wenn eine Schwachstelle ausgenutzt wird, überprüfen die eigenen Experten, welche Einfallstore sichtbar sind, welche Konfigurationen riskant wirken und wo überflüssige Berechtigungen Angriffschancen eröffnen. Auf diese Weise rückt die IT-Sicherheit näher an ein permanentes Risikomanagement heran, wird strategisch im Unternehmen verankert und nicht mehr nur als Einzelmassnahme verstanden. Das Leitmotiv dahinter lautet Prevention First: Bedrohungen sollen erkannt und beseitigt werden, bevor sie von einem echten Hacker ausgenutzt werden.
CTEM, Zero Trust und reaktive Sicherheit im Vergleich
Um den Wert von Continuous Threat Exposure Management vollständig zu erfassen, lohnt sich ein Blick auf andere gängige Sicherheitsansätze: Reaktive Lösungen wie Firewalls oder klassische Antivirensysteme greifen meist erst dann ein, wenn ein Angriff bereits erfolgt oder unmittelbar bevorsteht. Sie sind unverzichtbar, handeln aber typischerweise auf ein Ereignis hin.
Zero Trust verfolgt hingegen einen präventiven Architekturansatz: Niemand – nicht einmal interne Benutzer oder Systeme – erhält automatisch Zugriff. Jeder Zugriff wird überprüft, kontinuierlich validiert und kontextbezogen geregelt. Das reduziert Angriffsflächen systematisch, greift aber erst, wenn ein Zugriff erfolgt.
CTEM ergänzt beide Konzepte strategisch. Es analysiert kontinuierlich und bevor ein Angriff erfolgt, wie angreifbar eine IT-Landschaft aus Sicht eines Angreifers ist. Es fragt: Welche Systeme sind besonders exponiert? Welche Konfigurationen machen uns verwundbar? Und welche Risiken sind für das Geschäft wirklich relevant?
Während Zero Trust und reaktive Sicherheit den Zugriff kontrollieren und Angriffe bekämpfen, verfolgt Continuous Threat Exposure Management den Ansatz, Risiken frühzeitig zu identifizieren und im Sinne eines Prevention First-Gedankens gar nicht erst zur Ausnutzung kommen zu lassen. Unternehmen, die alle drei Ebenen kombinieren, erreichen damit ein ganzheitliches, proaktives Sicherheitsniveau.
Klassisch vs. kontinuierlich
In vielen Unternehmen dominieren nach wie vor klassische Vorgehensweisen: jährlich stattfindende Penetrationstests, manuelle Schwachstellenanalysen oder stichprobenartige Prüfungen von IT-Systemen. Diese Methoden haben zwar ihre Berechtigung, liefern aber meist nur eine Momentaufnahme der Sicherheitslage. Bis zur nächsten Prüfung können neue Schwachstellen entstehen, unentdeckt und unadressiert.
Ein weiteres Problem: Diese Prüfungen sind häufig nicht vollständig in die Geschäftsprozesse integriert. Ergebnisse werden zwar dokumentiert und Handlungsempfehlungen vorgeschlagen, doch eine echte Priorisierung auf Basis des Geschäftswerts der betroffenen Systeme findet selten statt. Auch Angriffssimulationen bleiben häufig punktuell, wodurch sich reale Bedrohungsszenarien nur schwer bewerten lassen.
CTEM setzt genau hier durch kontinuierliche Bewertung der IT-Sicherheitslage an, abgestimmt auf kritische Geschäftsprozesse, inklusive automatisierter Priorisierung und Validierung. Die Sichtweise verschiebt sich dabei von der Technik zur strategischen Risikobetrachtung. Das Ziel ist, Bedrohungen proaktiv zu verhindern, statt sie nur zu dokumentieren. Der Prevention-First-Gedanke zieht sich dabei durch alle Phasen: Risiken früh erkennen, richtig einordnen und gezielt entschärfen, bevor ein Angreifer sie ausnutzen kann.
In fünf Schritten zur belastbaren Sicherheitsstrategie
Ein professionelles CTEM-Programm folgt einem klar strukturierten Zyklus:
Scoping: Definition der zu analysierenden Bereiche und Assets
Discovery: Vollständige Erfassung aller IT-Komponenten inklusive Schatten-IT
Priorisierung: Bewertung der Risiken unter Einbezug von Bedrohungsdaten und Geschäftsrelevanz
Validierung: Überprüfung durch Angriffssimulationen oder Red-Teaming
Mobilisierung: Umsetzung konkreter Massnahmen zur Risikominimierung
Dieser Ablauf kann in regelmässigen Intervallen wiederholt werden, automatisiert oder unterstützt durch externe Dienstleister. Anders als bei rein projektbezogenen Sicherheitsprüfungen werden dabei nicht nur technische Schwachstellen erfasst, sondern auch strukturelle Mängel und organisatorische Versäumnisse sichtbar gemacht.
Continuous Threat Exposure Management, kurz CTEM, setzt auf eine kontinuierliche Bewertung der IT-Sicherheitslage, abgestimmt auf kritische Geschäftsprozesse, inklusive automatisierter Priorisierung und Validierung. (Quelle: Eset)
Wie Unternehmen Angriffsflächen frühzeitig erkennen
Ein mittelständisches Unternehmen setzt monatlich automatisierte Scans seiner hybriden Infrastruktur ein. Dabei entdeckt das System eine öffentlich erreichbare Administrationsschnittstelle auf einem Cloud-Asset. Mithilfe integrierter Angriffssimulationen lässt sich zeigen, dass ein Zugriff mit gestohlenen Zugangsdaten möglich wäre. Die Sicherheitsverantwortlichen priorisieren die Schwachstelle, beheben sie binnen eines Tages und dokumentieren den Vorfall für das nächste Audit.
In einem anderen Fall identifiziert ein automatisierter CTEM-Prozess, dass ein Dienst mit veralteter Software betrieben wird, für die kürzlich ein Exploit veröffentlicht wurde. Noch bevor ein Angriff stattfinden kann, wird das System isoliert und gepatcht. Die Bedrohung ist entschärft und der Vorfall wird gleichzeitig genutzt, um Prozesse zur Patch-Verteilung zu optimieren.
Was Unternehmen konkret von CTEM haben
Continuous Threat Exposure Management schafft Transparenz: Unternehmen erhalten ein realistisches Bild ihrer Sicherheitslage aus Sicht potenzieller Angreifer. So können Ressourcen gezielter eingesetzt, Risiken nachvollziehbar priorisiert und Sicherheitsmassnahmen effizienter geplant werden. Das schafft nicht nur Schutz, sondern auch Planungssicherheit.
Ein gut aufgesetztes Programm hilft Unternehmen dabei, Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen und zu schliessen, bevor sie zum Problem werden. Besonders in streng regulierten Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Energieversorgung oder der Finanzbranche ist das ein grosser Vorteil. Wer etwa den Anforderungen von NIS2 oder DORA gerecht werden muss, bekommt mit CTEM ein wirksames Werkzeug an die Hand, um technische und organisatorische Initiativen nicht nur einmalig, sondern dauerhaft umzusetzen.
Wie moderne Plattformen CTEM unterstützen
Auch wenn der Sicherheitsansatz kein einzelnes Produkt ist, lassen sich moderne Security-Plattformen so konfigurieren, dass sie CTEM unterstützen. Sie vereinen wichtige Funktionen wie Schwachstellenmanagement, Angriffserkennung und -bewertung, Threat Intelligence sowie die Möglichkeit, Sicherheitsvorkehrungen lückenlos zu dokumentieren und automatisch darauf zu reagieren.
Ergänzt wird dieses Portfolio idealerweise durch Security Services, KI-gestützte Analysetools und Managed Detection and Response (MDR). Gerade Unternehmen mit kleinen IT-Teams profitieren davon, weil sie so dauerhaft ein hohes Sicherheitsniveau halten können, ohne personell überfordert zu sein.
Machbarkeit und Mehrwert für Unternehmen
Grundsätzlich eignet sich CTEM für Unternehmen jeder Grösse. Wie es konkret umgesetzt wird, hängt allerdings stark davon ab, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und wie das Unternehmen seine Sicherheitsstrategie aufgestellt hat. Konzerne mit eigenen SOCs und umfangreichen IT-Teams können CTEM oft vollständig intern abbilden. Für den Mittelstand und kleinere Organisationen stellt sich hingegen die Frage nach der Umsetzbarkeit.
Doch auch diese Unternehmen müssen nicht auf CTEM verzichten. Durch Managed Security Services, insbesondere MDR-Angebote, lassen sich CTEM-Prozesse auslagern und bedarfsgerecht skalieren. Diese kombinieren automatisierte Bedrohungsanalysen, Echtzeitüberwachung und menschliche Expertise in einem Servicepaket, das auch für kleinere IT-Abteilungen realistisch nutzbar ist.
Der Sicherheitsansatz ist kein Luxus, sondern eine strategische Notwendigkeit in einer dynamischen Bedrohungslage. Ob intern aufgebaut oder extern betrieben: Wichtig ist, dass kontinuierlich geprüft, bewertet und gehandelt wird. Denn nur so lässt sich Prevention First konsequent umsetzen.
Laufende Bewertung der Risiken
Continuous Threat Exposure Management bedeutet einen echten Perspektivwechsel in der IT-Sicherheit. Statt auf einzelne Prüfungen zu setzen, geht es um eine laufende Bewertung der Risiken und darum, Gefahren frühzeitig auszuschalten. Unternehmen gewinnen damit nicht nur mehr Schutz, sondern auch die Fähigkeit, technisch, organisatorisch und strategisch dauerhaft widerstandsfähig zu bleiben. Am Ende ist CTEM nichts anderes als gelebtes Prevention First: kontinuierlich, nachvollziehbar und zuverlässig.
Die Autoren
Alexander Opel (links) ist Product Technology & Education Manager bei
Eset und seit 2016 beim slowakischen IT-Security-Anbieter an Bord.
Michael Klatte (rechts) arbeitet seit 2008 als IT-Journalist und PR-Manager für Eset Deutschland. Er betreut dort die B2B-Kommunikation für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH).